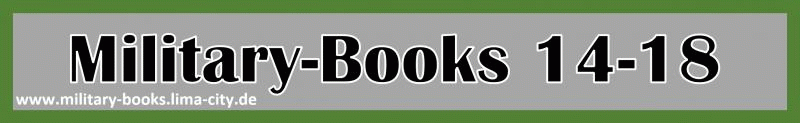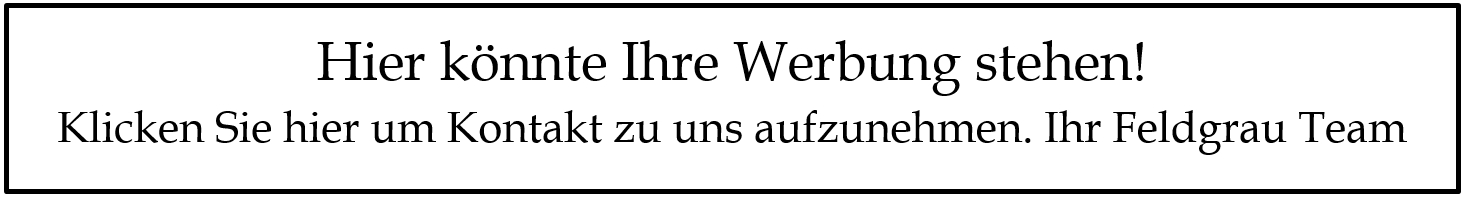gelöst Rätsel 239
Dieses Thema im Forum "Feldgraue Rätselecke" wurde erstellt von Red Baron, Aug. 6, 2014.



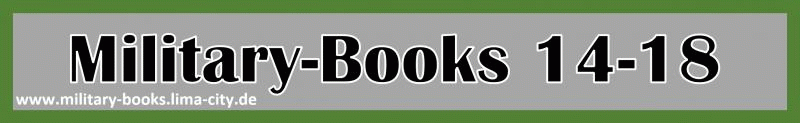






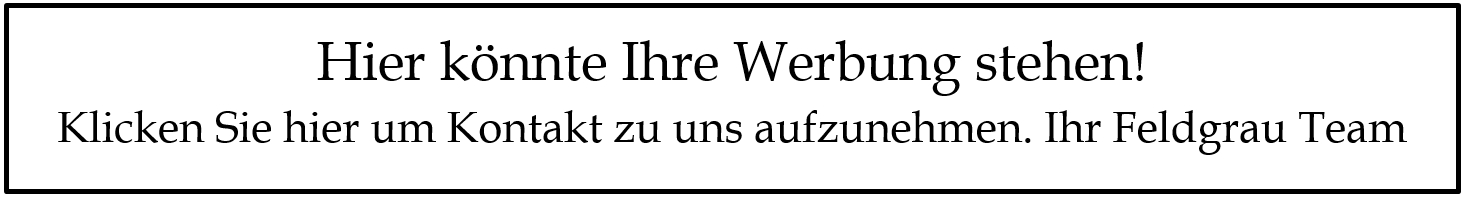
Dieses Thema im Forum "Feldgraue Rätselecke" wurde erstellt von Red Baron, Aug. 6, 2014.